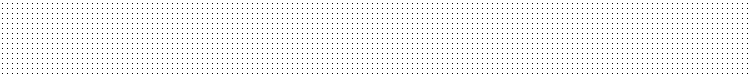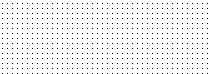Litigation-PR und prozessuale Wahrheitspflicht
29. September 2011 | Autor: Dr. Per Christiansen | Keine Kommentare | Artikel drucken
Ich frage mich, ob Litigation-PR mit der Pflicht nach § 138 ZPO in Konflikt geraten kann, Erklärungen über tatsächliche Umstände im Prozess vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben. Denken wir uns mal einen Fall. Eine Partei in einem Zivilprozess kommt auf die Idee, Litigation-PR nicht „bloß“ als Reputation-Management zu betreiben, sondern darüber hinaus medial über die Bande zu spielen und durch eine gezielte Meinungsmache das Gericht zu beeinflussen. Dabei trägt die Partei im Prozess wahrheitsgemäß und vollständig in den Schriftsätzen vor. In der medialen Kommunikation hingegen lässt sie allerdings wesentliche Punkte aus. Die öffentliche Wahrnehmung und die mediale Berichterstattung fallen dadurch günstiger aus, als dies bei Kenntnis aller Umstände der Fall gewesen wäre. Verstößt die Partei gegen die prozessuale Wahrheitspflicht nach § 138 ZPO?
Im ersten Reflex würde man dies verneinen. Zum einen hat die Partei im Prozess korrekt vorgetragen. Zum anderen sind Kommunikationsmaßnahmen gegenüber den Medien keine Prozesshandlungen, für die die prozessuale Wahrheitspflicht nur gilt. Wenn man aber genauer hinsieht, kann man Zweifel bekommen. Die prozessuale Wahrheitspflicht wird allgemein subjektiv verstanden. Das bedeutet: Wenn man subjektiv glaubt, alle Tatsachen vollständig und richtig vorgetragen zu haben, dies objektiv aber nicht stimmt, hat man im Ergebnis der Wahrheitspflicht Genüge getan. Muss man dann nicht auch umgekehrt sagen: Wer subjektiv glaubt, über ein medial erzeugtes manipuliertes Bild den Prozess beeinflussen zu können, verstößt gegen seine Wahrheitspflicht? § 138 ZPO hat den Zweck, ein faires Verfahren zu gewährleisten. Würde man nicht sagen, in einem fairen Verfahren dürften die Parteien solche Spielchen nicht spielen?
Soviel zur Theorie. Als PR-Agentur kann man diesem juristischen Problem leicht ausweichen: Man kommuniziert nicht Tatsachen, sondern Meinungen.
Ihre Meinung?
Haft und fünf Jahre Kommunikationsverbot
28. September 2011 | Autor: Jens Nordlohne | Keine Kommentare | Artikel drucken
Ein 25-jähriger Brite muss nicht nur für 18 Wochen ins Gefängnis, sondern auch für fünf Jahre auf die Nutzung von Facebook, Twitter und YouTube verzichten. Der Mann hatte im Internet geschmacklose Kommentare zum Tod von vier Teenagern abgegeben. Er postete sowohl auf Trauerseiten als auch auf den Pinnwänden von Angehörigen unflätige Äußerungen und selbst erstellte Videos. So montierte er beispielsweise das Porträt eines Mädchens, das sich vor einen Zug geworfen hatte, auf eine Comic-Lokomotive.
Der Guardian zitiert den Richter bei der Urteilsverkündung: „Sie haben hinterbliebenen Freunden und Verwandten, die in Trauer waren, weiteres unermessliches Leid zugefügt. Die Vergehen sind so ernst, dass nur eine Freiheitsstrafe angemessen erscheint.“
Die Öffentlichkeit als Richter
26. September 2011 | Autor: Jens Nordlohne | Keine Kommentare | Artikel drucken
Der Verein Forum Recht und Kultur im Kammergericht e.V. lädt für Donnerstag, 29. September 2011, 18.00 Uhr, Plenarsaal des Kammergerichts, Elßholzstr. 30 – 33, 10781 Berlin zu einer seiner Veranstaltungen ein. Der Medienrechtler und Rechtstheoretiker Dr. Dr. Volker Boehme-Neßler, Professor an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft, wird einen Vortrag halten zum Thema „Die Öffentlichkeit als Richter? Litigation-PR als Chance und Risiko für die Justiz in der Mediengesellschaft“. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenlos. Am Ende des Programms besteht bei kleinem Imbiss und Getränken Gelegenheit zum Gedankenaustausch.
Veranstaltungshinweis
9. August 2011 | Autor: Dr. Per Christiansen | Keine Kommentare | Artikel drucken
Für Interessierte: Am 10. November findet in Köln eine Veranstaltung des Otto-Schmidt-Verlages zum Urheber- und Medienrecht statt (mit der wir nichts weiter zu tun haben). Auf der Tagesordnung steht auch ein Streitgespräch „Litigation-PR – Grenzen der Berichterstattung in Strafverfahren“, das insbesondere den Fall Kachelmann aufarbeiten soll. Da die Veranstaltung kostenpflichtig ist, lohnt sie sich aber wohl nur für diejenigen, die sich zugleich auch für sonstige Themen im Urheber und Medienrecht interessieren. Mehr auf der Website des Verlages.
Tags: Kachelmann > Veranstaltungshinweis
Scheinheiliges, zynisches Spiel
28. Juli 2011 | Autor: Jens Nordlohne | Keine Kommentare | Artikel drucken
Der Vorsitzende des Richterbundes, Christoph Frank, schreibt in einem lesenswerten F.A.Z.-Gastbeitrag allen Prozessbeteiligten der Causa Kachelmann ins Stammbuch, welche Rolle sie in einem rechtstaatlichen Verfahren einzunehmen haben. Er fordert, sich „auf die Grundsätze des Strafprozesses zu besinnen.“ Besonders kritisiert er das Verhalten der Medien: „Es ist ein scheinheiliges, vordergründiges und zynisches Spiel mit den Belangen des Opferschutzes, wenn Opfer medial stigmatisiert werden, zugleich aber wirksamere Opferschutzregeln eingefordert werden. Interviews mit Zeuginnen vor ihrer Vernehmung in der Hauptverhandlung begründen eine neue Qualität der Unkultur der medialen Steuerung von Strafprozessen. Die Zeuginnen sind in ihrer Doppelrolle als Gesprächspartner einerseits und unter der Wahrheitspflicht stehende Prozessbeteiligte andererseits überfordert. Sie werden der Gefahr ausgesetzt, dass ihre Glaubwürdigkeit sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in der Beweiswürdigung durch das Gericht in Zweifel gezogen wird. Und zwar umso mehr, wenn Widersprüche bei einer Vernehmung unter Ausschluss der Öffentlichkeit von dieser nicht unmittelbar wahrgenommen und bewertet werden können. Es entstehen unterschiedliche Erkenntnisebenen, welche die Hauptverhandlung entwerten und die Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen aufheben.“
Frank kommt zu dem Schluss: „Der Fall Kachelmann mit all seinen negativen Begleiterscheinungen in der Berichterstattung ist nicht typisch für die strafrechtliche Aufarbeitung von Gewalt- und Sexualdelikten. Dass dies so bleibt, liegt in der Verantwortung aller Akteure innerhalb und außerhalb der Gerichtssäle.“
Wenn du nur geschwiegen hättest…
18. Juli 2011 | Autor: Dr. Per Christiansen | 1 Kommentar | Artikel drucken
Litigation-PR ist dann besonders gut und wirksam, wenn sie nicht zu sehen oder zu merken ist. Dieser Satz, der von Boehme-Neßler stammt, könnte wahrer nicht sein.
„Kachelmann kämpft gegen Leser-Kommentare“ titelt Legal Tribune Online. Ein Paradebeispiel für die Situation, in der Litigation-PR nicht nur sichtbar, sondern sogar Gegenstand einer eigenen Berichterstattung wird. In dem Bericht geht es um Verfahren, mit denen die Anwälte von Jörg Kachelmann missliebige Äußerungen aus dem Internet zu entfernen versuchen. Ist dem Betroffenen und seiner Reputation wirklich gedient, wenn er medial als jemand dargestellt wird, der Kommentare von Nutzern im Internet „unterdrücken und zensieren“ möchte? Es sollte sich herumgesprochen haben, dass Foren und soziale Medien äußerst sensibel auf Beeinflussungsversuche reagieren. Kommunikativ sollte man abwägen, ob es nicht besser ist, bestimmte Äußerungen in solchen Medien einfach hinzunehmen, weil sie ohnehin nicht mehr gelesen werden und in dem unendlichen Datenstrom weiterer belangloser Kommentare für immer vergraben werden.
Betroffenen kann man nur raten, den eigenen Anwälten keine freie Hand bei der Beseitigung von unerwünschten Äußerungen zu lassen, sondern sich die Genehmigung jeden neuen Schrittes unter Einbeziehung der Kommunikatoren vorzubehalten. Ansonsten haben Anwälte den Anreiz, mit Suchmaschinen immer neue Fälle aufzutun und gesondert abzurechnen. Solche Gelddruckmaschinen zahlen im Ergebnis zwar normalerweise die Gegner, jedoch können die kommunikativen Belange des Betroffenen dann leicht aus dem Fokus geraten.
Literaturempfehlung: PR-Arbeit der Justizpressesprecher
21. Juni 2011 | Autor: Dr. Per Christiansen | Keine Kommentare | Artikel drucken
In Kommunikation & Recht 2011, 234 erörtern Pruggmaier/Möller die Befugnisse und Verpflichtungen von Justizpressesprechern. Im Schwerpunkt zeigen die Verfasser die rechtlichen Grenzen für die Öffentlichkeitsarbeit auf, die sich aus der Zugehörigkeit der Sprecher zu den Justizbehörden als staatlicher Stelle ergeben.
Der Artikel ist lesenswert, weil er zeigt, weshalb Justizpressesprecher sich oft so zurückhaltend und wenig mitreißend äußern (müssen). In der Grundtonalität scheinen die Verfasser aber in der Öffentlichkeitsarbeit eher ein lästiges Übel zu sehen, etwas, das man halt machen muss, obwohl es so kompliziert und voller Stolpersteine ist. Dabei liegt in der Arbeit von Pressesprechern der Justizbehörden eine große Chance. Die Sprecher kommunizieren Lösungen, die von Richtern in oftmals akribischer Arbeit zwar für den Einzelfall entwickelt wurden, die aber dennoch von Allgemeininteresse sein können. Sie können medial die general-präventive Wirkung des Strafrechts verschärfen. Vor allem aber können sie die Wahrnehmung der Bürger maßgeblich beeinflussen, in einem verlässlichen und fundiert arbeitendem Rechtsstaat zu leben. Und das ist es alle Mal wert.
Tags: Gericht > Justiz > Justizbehörde > Justizpressesprecher
Irrweg des Rechts?
16. Juni 2011 | Autor: Jens Nordlohne | Keine Kommentare | Artikel drucken
„Ist hier jemand schuldig gesprochen worden, weil Eltern eines Unfallopfers einen Schuldigen suchen?“ Diese Frage stellt das Neue Stader Wochenblatt in einer Titelstory mit der Überschrift „Gutachter zählt mehr als Zeugen“. Die Geschichte ist ein interessantes Beispiel dafür, die Diskrepanz zwischen öffentlichem Rechtsempfinden und juristischer Urteilsfindung darzustellen.
Der Fall: Im April 2009 kam der 27jährige Marcel K. bei einem Autounfall ums Leben (Wochenblatt: „Horrorcrash mit Mercedes Cabrio bei riskantem Überholmanöver.“) Hinter einem Traktor auf einer Landstraße hatte sich eine Schlange gebildet. Marcel K. überholte die Fahrzeuge in dem Moment als der Traktorfahrer Johann B. mit seinem Gefährt abbog. Der Fahrer rammte dabei den Traktoranhänger und verstarb an den Folgen des Unfalls. (Wochenblatt: „…ein rasanter Fahrer rollte die Schlange mit seinem PS-starken Flitzer auf, der Zusammenstoß war unvermeidlich“)
Das Buxtehuder Amtsgericht sprach nun dem Traktorfahrer eine Mitschuld zu. Ein DEKRA-Sachverständiger kam zu dem Ergebnis, dass der Obstbauer sieben bis acht Sekunden Zeit gehabt hätte, sich umzusehen und den Unfall zu vermeiden. Der Traktorfahrer wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Ein klarer Fall, ein eindeutiges Urteil?
Mitnichten – zumindest in den Augen der Lokalpresse und der Öffentlichkeit vor Ort. Johann B. ist ein bekannter und geachteter Obstbauer aus dem Alten Land vor den Toren Hamburgs. Mehrere Zeugen hatten ihn nach Ansicht der Medien entlastet. Wochenblatt: „Obwohl mehrere Zeugen aussagten, der Mercedes sei angebraust und herangeschossen, verurteilte die Buxteuder Amtsrichterin Katharina Niezgoda den Obstbauern B. wegen fahrlässiger Tötung.“ Das Blatt fühlt weniger mit dem getöteten Fahrer als mit dem Verurteilten: „Schmerzlicher wird für den Verurteilten sein, dass er nun damit leben muss, als Mitschuldiger am Tod von Marcel K. angesehen zu werden.“
Dem DEKRA-Experten traut der Berichterstatter wenig zu: „Der Sachverständige Albrecht Hocks hat per Taschenrechner die Zeugenaussagen in Zahlen verwandelt. Sein Fazit: B. hatte Zeit gehabt, das herannahende Cabrio zu erkennen.“
Auf der einen Seite also ein orstbeliebter Obstbauer und Zeugen, die eindrucksvoll und plastisch ein – unbestrittenes – Fehlverhalten des Marcel K. bestätigen. Auf der anderen die Eltern des Todesopfers, die ihr Recht als Nebenkläger wahrnehmen und Johann B. vor Gericht bringen, ein nüchterner Sachverständiger, der anhand von Daten feststellt, dass der Obstbauer Zeit gehabt hätte zu reagieren und eine Richterin, die eben jene Fakten in ihrer Urteilsfindung berücksichtigt.
Und das Fazit des Wochenblatts? „Nicht nur der, der vorsätzlich falsch handelt, trägt Schuld, sondern immer auch der Betroffene solcher Fehler. Ein Irrweg des Rechts?“
Der Autor der Story, Jörg Dammann, legt in seinem Kommentar nach: „Gilt in Prozessen nur das Wort des Gutachters? In dem Verfahren wischen Staatsanwalt und Richterin die Aussagen beiseite, die den Angeklagten entlasten. Sie verlassen sich ohne Prüfung auf die Zahlen, die ein Sachverständiger aus dem Stehgreif berechnet. „Es ist beeidruckend, wenn Justiz und Ingenieurskunst aufeinander treffen“, gerät der Ankläger ins Schwärmen. Für mich ist eher beeindruckend, wie wenig Zeugen zählen, die übereinstimmend von einem riskanten Überholmanöver berichten. Der Obstbauer muss nun sehen, wie er mit dem Schuldspruch zurechtkommt. Helfen wird das Urteil wahrscheinlich den Eltern. Was mag sie bewegt haben, einen Prozess anzustrengen, obwohl die Staatsanwaltschaft das Verfahren bereits eingestellt hatte?“
Kommunikationsstrategie im Kugelhagel: Bin Ladens Tod und Litigation-PR
11. Mai 2011 | Autor: Dr. Per Christiansen | Keine Kommentare | Artikel drucken
Osama Bin Laden wurde getötet und kann jedenfalls von irdischen Gerichten nicht mehr für seine Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Die Berichterstattung über diese Vorgänge trägt dennoch deutliche Züge von Litigation-PR. Das gezielte Staatsattentat – sofern es ein solches war – ist straf-, verfassungs- und völkerrechtlich heikel. Entsprechend ist die US-Regierung in die Situation geraten, die Tötung gegen die Kritik zu rechtfertigen, durch ein solches „Kill-Kommando“ seien fundamentale rechtsstaatliche Werte verraten worden, derer wir uns sonst so rühmten.Die kommunikative Verteidigung der US-Regierung arbeitet mit für die Laiensphäre aufbereiteten juristischen Argumenten. Fast, als ob sich die Regierung in einem Prozess (an den Stammtischen der Welt) zu verantworten hätte. Zeichnen wir das Bild nach:
Zunächst einmal vermeidet die US-Regierung jede Terminologie, die einen finalen Todesschuss als das bezeichnet, was es ist. Dies würde nur ein kommunikatives Präzedenz setzen. Die genauen Umstände der Tötung wurden jedenfalls anfänglich nur vage und lückenhaft erläutert. Den Rest mussten sich Leser und Zuschauer selbst denken und ergänzen. Dabei ist es doch nur plausibel, wenn bei einem Feuergefecht zwischen High-Tech-Elite-Troopers und mordenden Terroristen im Kugelhagel ein Akteur getroffen wird. Dies wäre ein Szenario, welches auf fehlenden (direkten) Tötungsvorsatz abzielt. Ebenso plausibel wäre es, wenn sich ein Soldat im Kampf durch den Schuss seines Lebens erwehren musste. Dies wäre ein Notwehr-Szenario. Solange sich die öffentliche Wahrnehmung in diesen Bahnen bewegte, war die Kommunikation der US-Regierung unter Kontrolle.
Einem cleveren Journalisten ist dann aber die Frage zu verdanken, ob Bin Laden überhaupt bewaffnet war. Dies musste verneint werden. Zweifel an den Szenarien einer ungewollten oder in Notwehr ergangenen Tötung waren damit vorprogrammiert. Seltsam der Kommentar der US-Regierung dazu: Bin Laden sei zwar nicht bewaffnet gewesen, habe sich aber „in anderer Form“ gewehrt. Weitere Informationen wurden nicht geliefert. Man kann nur versuchen sich vorzustellen, wie sich ein unbewaffneter Mann gegen eine hochgerüstete Kampfmaschine der US-Truppen ernstlich hätte wehren können. Die Äußerung der US-Regierung kann nur als halbherziger Versuch gewertet werden, Vorstellungen einer ungewollten Tötung weiter aufrecht zu erhalten. Diese kommunikative Maßnahme wurde allerdings mit Einbußen an der eigenen Glaubwürdigkeit bezahlt.
Dann folgte ein kommunikativer Strategiewechsel. Jetzt ging es nicht mehr um die konkrete Situation, sondern um die Gefahren, die von Bin Laden generell ausgingen. Die beschlagnahmten Festplatten hätten Planungen auf weitere Attentate gezeigt (weitere Informationen wurden wieder nicht gegeben). Juristisch würde man diese Argumentation als eine Rechtfertigung durch Notstand bezeichnen. Dieses Argument überzeugt jedoch auch in der juristischen Laiensphäre nur wenig. Die Verteidigung von Rechtsgütern vor allem durch Tötung kommt nur bei akuten gegenwärtigen Gefahrenlagen in Betracht, und eine solche lag nicht vor. Kommunikativ wurde so etwas wie eine „latente Dauergefahr“ gezeichnet, die jederzeit in eine akute Notsituation umspringen kann. Weshalb diese Gefahr jedoch nicht durch eine Verhaftung hätte beseitigt werden können, wurde nicht erklärt. Hinzu kommt: Jedenfalls in unserer Verfassung ist es verankert, dass Leben nicht gegen Leben abgewogen werden kann. Eine Tötung (außerhalb von Notwehr) wird nicht dadurch rechtmäßig, dass sie andere Leben rettet.
Im Folgenden kommunizierten die US-Sprecher juristisch immer nebulöser, im Tonfall aber lauter: Die Tötung des gefährlichsten Mannes der Welt sei ohne Zweifel gerechtfertigt, hieß es. Juristisch übersetzt: Die Tötung sei aufgrund eines übergesetzlichen Notstandes ausnahmsweise gerechtfertigt. Juristisch ist das wirklich dünnes Eis. Und noch drastischer: Wer Zweifel an der Richtigkeit der Operation habe, solle sich untersuchen lassen, ob er hirnkrank sei. Was für eine Ausdrucksweise! Jedem Juristen liegt reflexartig der alte Erfahrungssatz der Rechtswissenschaften auf der Zunge: Wer schreit, hat Unrecht.
Versetzt man sich in die Lage der Sprecher der US-Regierung, kann man mit den Resultaten der eigenen Kommunikationsmaßnahmen nicht glücklich sein. Aber hätte es überhaupt eine alternative Kommunikationsstrategie gegeben? Was wäre gewesen, wenn man von Beginn an offen gesagt hätte, eine gezielte Tötung durchgeführt zu haben? Dies wäre einem Eingeständnis gleichgekommen, aus Gründen der Staatsräson das Recht verletzt zu haben. Hätte die Öffentlichkeit dann nicht mit einem noch größeren Aufschrei reagiert? War es nicht vielleicht doch geschickt, die nach der Operation unvermeidliche öffentliche Diskussion jedenfalls durch die Positionierung von möglichen Gegenargumenten aufzuweichen und insgesamt hinzuziehen, bis der Nachrichtenwert gesunken ist? Dies ist eine Entscheidung, vor die Kommunikatoren oftmals gestellt sind. Soll man einen medialen Konflikt durch gezielte Maßnahmen aufzuweichen versuchen, auch wenn dies auf Kosten der eigenen Glaubwürdigkeit geht? Diesen Weg ist die US-Regierung in diesem Fall offenbar gegangen.
Neuer Blog-Herausgeber: Rechtsanwalt Dr. Per Christiansen
27. April 2011 | Autor: Jens Nordlohne | Keine Kommentare | Artikel drucken
Der Litigation-PR-Blog hat einen neuen Herausgeber: Dr. Per Christiansen wird ab sofort zusammen mit Jens Nordlohne die Themenwelt rund um Juristerei, Kommunikation und Reputationsmanagement beleuchten. Dr. Per Christiansen, MSc (LSE) studierte Rechtswissenschaften und Philosophie an der Universität Kiel und Regulierungswissenschaften an der London School of Economics. Zuletzt war er als Leiter Recht und Personal der AOL-Gruppe und als Vorstandsmitglied der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia e.V. tätig. Seit August 2010 ist er Senior Visiting Research Fellow am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung mit den Forschungsschwerpunkten der Medienregulierung im internationalen Umfeld sowie der Bekämpfung von strafbaren Inhalten. Per Christiansen ist Rechtsanwalt und Vorstandsmitglied der Stiftung Digitale Chancen.
Herr Christiansen: Was ist wichtiger? Recht zu bekommen oder recht gut dazustehen?
Wichtig ist, das eigene Ziel zu erreichen. Bekommt man Recht und steht trotzdem schlecht da (wir denken an Michael Kohlhaas), hat man für die eigenen Zwecke nicht viel erreicht. Sieht man medial gut aus, bekommt der Gegner aber Recht, hat man auch nicht viel gewonnen. Meiner Erfahrung nach kommt es darauf an, zunächst das Ziel eines Mandanten präzise zu verstehen. Und dieses Ziel ist niemals nur ein juristisches, sondern ein der Lebenswelt des Mandanten entstammendes Interesse an einem Vermögens- oder Lebenssachverhalt. Für ein solches Ziel ist der juristische Sieg nur Mittel zu dessen Erreichung, und in vielen Fällen überhaupt nur der erste Schritt. In einer umfassenden Beratung und Strategieentwicklung für den Mandanten muss man sich fragen, ob man das Ziel des Mandanten mit einem juristischen Sieg schon vollständig erreicht haben wird oder ob nicht weitere Instrumente und Mittel hinzukommen müssen. In einer optimalen Strategie steht der Mandant dann mit Recht recht gut da.
In welchen juristischen Bereichen sehen Sie eine sinnvolle Kooperation von Anwalt und Kommunikationsexperten?
Es kommt weniger auf das Rechtsgebiet als vielmehr auf das Öffentlichkeitsinteresse an der konkreten Sache an. Bauplanungsrecht zum Beispiel würde man auf den ersten Blick nicht als eine Materie sehen, in der Kommunikationsexperten gebraucht würden. Das ändert sich aber schlagartig bei Großvorhaben wie Stuttgart D-21, Flughafenerweiterungen (Airbus Hamburg) oder dem Bau von Autobahnen. Allerdings gibt es Rechtsgebiete, in denen die Zusammenarbeit mit Kommunikationsexperten bereits etabliert ist, etwa Strafverfahren und Verfahren wegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen bei Rehabilitationsinteresse, bei öffentlichen Tarifauseinandersetzungen oder in Regulierungsverfahren. In anderen Bereichen scheint es mir noch erhebliches Potential zu geben, beispielsweise in der Kommunikation von Ermittlungsbehörden, die kaum strategisch zur präventiven Verbrechensbekämpfung genutzt wird.
Wer führt? Jurist oder Kommunikationsberater?
In laufenden Verfahren führt der mit der Prozessführung betraute Anwalt. Völlig natürlich wird ein Prozessvertreter auch ohne Kommunikationsberatung seinem Mandanten einbläuen, jegliche Kommunikation müsse von nun an über ihn laufen. Unbedachte Kommunikation kann irreparable Nachteile in der Verhandlungsführung verursachen. Nichts anderes gilt, wenn man in dem juristischen Konflikt die Mittel um gezielte und professionelle Kommunikationsmaßnahmen ergänzt. Allerdings gehört es zu den Aufgaben des koordinierenden Juristen, die kommunikativen Belange gegenüber juristischen Risiken im Interesse des Mandanten abzuwägen und sich laufend aktiv mit den Kommunikatoren abzustimmen. Im Idealzustand entwickelt der Jurist ein Gefühl für geschickte Kommunikation (vor allem den richtigen Zeitpunkt) und der Kommunikator ein Gefühl für juristische Risikovermeidungsstrategien.
Haben Sie als Jurist schon mal mit PR-Beratern zusammengearbeitet?
Oft. Sehr oft.
Als ehemaliger Justiziar eines international tätigen Unternehmens: Gibt es Anknüpfungspunkte zwischen der Rechtsabteilung und der Pressestelle? Wie sollten diese aussehen? Wie sieht diese Zusammenarbeit in anderen Ländern aus?
Es gibt verschiedene Anknüpfungspunkte. Es gibt juristische Verfahren, die sich für eine mediale „Ausschlachtung“ oder gar für Image-Zwecke bestens eignen. Beispielsweise Verfahren, die letztlich Kunden zugute kommen wie z.B. Verfahren gegen Spammer oder Internet-Betrüger. In anderen Verfahren kann die mediale Berichterstattung ein Angriffs- oder Verteidigungsmittel außerhalb des juristischen Schlachtfeldes sein, etwa um für den Gegner den zu kalkulierenden Schaden bei Fortführung des Konfliktes zu erhöhen. Generell ist es nach meiner Erfahrung wichtig, sich bei Verfahren mit der Pressestelle laufend zu koordinieren, um einerseits selbst geschickt kommunizieren zu können, und andererseits, um für mögliche kommunikative Angriffe des Gegners vorbereitet zu sein. Vor allem letzteres hat sich in meiner Erfahrung in etlichen Verfahren bezahlt gemacht. Gelegentlich habe ich die Hilfe von Kommunikatoren auch in Anspruch genommen, wenn es zu erwarten war, dass ein Schreiben außerhalb des Verfahrens der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
Ein weiterer Anknüpfungspunkt ist das Risikomanagement. So wie es der Rechtsabteilung obliegt, juristische Risiken für das Unternehmen durch geeignete Maßnahmen abzufedern, ist dies für kommunikative Risiken die Aufgabe der Unternehmenskommunikation. Es hat sich als sinnvoll erwiesen, sich über akute und auch mögliche abstrakte Risiken auszutauschen und je nach den Umständen des zu betreuenden Unternehmens sogar in Teams zu institutionalisieren. Risiken können ein Unternehmen auf vielen verschiedenen Ebenen treffen, entsprechend „interdisziplinär“ sollte das Risikomanagement darauf vorbereitet sein.
In der Rechtspolitik und bei der Begleitung von Gesetzgebungsverfahren schließlich ist die juristische Bewertung ohnehin nur der erste Baustein und die Basis für kommunikative Maßnahmen.
Die Zusammenarbeit zwischen Rechtsabteilung und Pressestelle liegt im Grunde in der (anglo-amerikanischen) Philosophie der Funktion des Unternehmensjuristen als „General Counsel“, der über die eigentliche Rechtsberatung hinaus Risiken und Chancen für das Unternehmen verantwortlich und übergreifend managen soll. Also ganz anders als die „klassische“ Positionierung der Rechtsabteilung als einer nicht weiter verantwortlichen rechtlichen Kontrollinstanz für den Vorstand. Je unternehmerischer und für die Unternehmensziele verantwortlicher ein Unternehmensjurist zu denken hat, desto mehr leitet ihn das zwangsläufig in eine Zusammenarbeit mit der Unternehmenskommunikation.